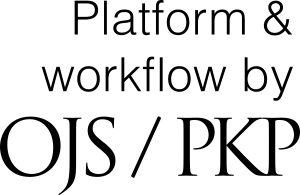In Kooperation mit
und bidokbib, der barrierefreien digitalen Bibliothek von bidok
3-2023
Liebe Leser*innen von Inklusion-Online,
immer wieder erreichen uns dankenswerterweise frei eingereichte Beiträge aktueller Forschungen und Essays zu inklusionstheoretischen Aspekten - ein Beleg dafür, dass inklusionsorientierte Entwicklungen, wenn auch nicht unbedingt immer im Fokus des aufmerksamkeitsökonomisch ausgerichteten Medieninteresses stehen, so doch nach wie vor eine gesamtgesellschaftliche Gestaltungsaufgabe im Sinne der UN-BRK darstellen, die mit anhaltenden wissenschaftlichen, praktischen und politischen Herausforderungen verbunden ist. Für die freien Einreichungen an dieser Stelle unseren herzlichen Dank. Sie führen dazu, dass diese Ausgabe wieder einmal ohne ausdrückliches Schwerpunktthema auskommen muss, deshalb jedoch nicht weniger wissenschaftliche Aufmerksamkeit verdient und zu kritischer Reflexion herausfordern mag.
Constance Remhof und Martin F. Reichstein hinterfragen die Reaktionen, denen sich Eltern, die als ‚geistig behindert‘ gelten, heute ausgesetzt sehen. Integrations- und inklusionsbewegte Zeiten mögen dazu geführt haben, dass inzwischen weniger der Frage der Elternschaft selbst, als vielmehr deren Ausgestaltung mit öffentlichen und institutionalisiertem Mistrauen begegnet wird. Untersucht wird das ‚Exklusionsrisiko Elternschaft‘ in Einrichtungen für Familien, in denen Eltern mit zugeschriebener geistiger Behinderung wohnen. Im Zusammenhang mit Unterstützungsangeboten und auf Basis der zugrundeliegenden Konzepte wird der Frage nachgegangen, welche exkludierende Mechanismen sich in welcher Weise auf die Lebenswirklichkeit der Adressat:innen auswirken.
Auch Miriam Düberfokussiert Eltern mit zugeschriebener Lernbehinderung und die Barrieren, denen diese sich einstellungsbedingt nach wie vor gegenübergestellt sehen. In diesem Zusammenhang scheinen bestehende und überdauernde Vorstellungen von guter Elternschaft und funktionierenden Familien auch noch in erheblichem Ausmaß zu einer unterstellten „(Erziehungs-)Unfähigkeit von Menschen mit Lernschwierigkeiten“ verbunden zu sein. Auch haben diese Vorstellungen erheblichen Einfluss auf die grundsätzlichen Auseinandersetzungsprozesse der potenziellen Eltern mit reproduktiven Fragen. Damit sieht sich neben der ‚reproduktiven Selbstbestimmung‘ auch die Legitimität einer Elternschaft an sich durchaus noch in Frage gestellt. Der Beitrag rekonstruiert und diskutiert den diesbezüglichen oft unzureichenden Stand der empirischen Sozialforschung. Neben einem Qualifizierungsbedarf im Hinblick auf sämtliche Sozialisationsinstanzen verweist Miriam Düber darauf, dass sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung bislang vor allem auf Einrichtungen im Feld der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen konzentriert hat.
In einem anderen Handlungskontext befasst sich Lena Ludwig mit der Wirkung von handlungs- und haltungspraktischen Bedingungen in inklusionsorientierten Kontexten. Im Rahmen einer mehrebenanalytischen Betrachtung von sich als inklusiv verstehenden Gymnasien wird die in einem solchen konzeptionellen Unterrichtsverständnis tabuisierte Zuschreibung behindert/nicht behindert auf ihre unterschwellig anhaltende Wirksamkeit hin untersucht. Eine ostentative Programmatik der De-Kategorisierung allein hebt demnach deren folgenreiche Bedeutung noch keineswegs auf, sondern führt vielmehr zu einer Maskierung von Differenzwahrnehmung und -markierung. Die Untersuchung führt zu der These, dass „Maskierungen von Lehrkräften mit einer hohen Brisanz einhergehen, so sie im unterrichtlichen Handeln weitestgehend versuchen, vermeintlich illegitime Differenzsetzungen zu verdecken und verdeckt zu lassen, wenn Schüler:innen sie offenlegen oder thematisieren“.
Katharina Silter, Johanna Hilkenmeier, Iris Beck, Nicole Franke und Ingolf Prosetzkyliefern erste Befunde zu den wahrgenommenen Belastungen und Ressourcen von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen während des ersten COVID-19-bedingten Lockdowns in Deutschland. Es geht um die individuellen Erfahrungen von insgesamt 129 Personen mit und ohne Beeinträchtigungen nach dem ersten pandemiebedingten Lockdown im Jahr 2020. Die Datengrundlage wurde mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse und einem induktiven Ansatz ausgewertet. Es erwiesen sich bestimmte Aspekte wie Gesundheitsversorgung, körperliche Unversehrtheit oder fehlendes Kontrollerleben als besonders relevant für Personen mit Beeinträchtigungen oder Unterstützungsbedarf. Besondere Bedeutung kommt dabei den bereits im Vorfeld bestehenden Benachteiligungen und Bedingungen zu, die durch die Krise nur umso virulenter zum Vorschein traten. Neben diesem Brennglaseffekt bestätigt sich auch die Vermutung, dass die Sorge um die zukünftige öffentliche und politische Wahrnehmungsbereitschaft gegenüber Inklusionserfordernissen und nachhaltige Einschränkungen, mit denen sich die Betroffenen auch in Zukunft konfrontiert sehen, deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Die Ergebnisse dieser Teilstudie bestätigen und ergänzen bisherige Forschungsbefunde zu pandemiebedingten Herausforderungen und Ressourcen.
Bernhard Rauhschlägt vor, den Inklusionsbegriff diskursiv von theoretischen Unschärfen zu entlasten und spricht von ‚Transklusion‘, wenn es um inklusionsorientierte Transformationsprozesse gehen soll. Auch wenn das proklamierte Ziel letztendlich als inklusiver Zustand zu denken ist, haben wir es handlungspraktisch doch stets mit spezifischen Verhältnisbestimmungen von Inklusion/Exklusion zu tun – diese werden in systemtheoretischer Tradition raummetaphorisch interpretiert, während die Dimension Zeit, im Sinne von Veränderungsprozessen, dem untergeordnet erscheint. Inzwischen wird erkannt, dass „die Scheinsicherheit von eindeutiger Inklusion und Exklusion die Entstehung von Neuen behindert und dass die Ausarbeitung dialektischer Relationen von Inklusion und Exklusion theoretisch produktiver ist als eine Dichotomisierung“. Um ausgehend von dieser Phase des Stands der Inklusionsdebatten zukünftig diese zu qualifizieren, wäre eine „Transformation der in uns eingeschriebenen Deutungsmuster und Machtverhältnisse“ vonnöten, die sich als geeignet erweist, den Stand der Dinge weiter zu verändern.
Andreas Hinz stellt vor dem Hintergrund des Zusammenhangs von inklusiver und demokratischer Bildung Überlegungen zu einer intersektionalen Revitalisierung der Inklusionsdebatte an. Dabei knüpft er an einen früheren Text in dieser Zeitschrift an, der eine Zwischenbilanz zur Entwicklung inklusiver Bildung nach zehn Jahren Gültigkeit der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) zog (vgl. Hinz 2013). Mittlerweile habe sich die Dringlichkeit der anstehenden Fragen jedoch verschoben – im Vergleich zu vor 10 Jahren haben wir es heute im Zusammenhang mit der Anwendung der UN-BRK mit Stagnation und teilweisen Roll-Backs zu tun. Damit wäre der Inklusionsdiskurs demokratietheoretisch zu reflektieren, wenn nicht zu re-politisieren, was einen konsequenten intersektionalen Zugang erfordert. Der ist bislang nicht selbstverständlich, weshalb zwar der Slogan „Demokratie braucht Inklusion“ einsichtig erscheint, die Bedeutsamkeit seiner Umkehrung – „Inklusion braucht Demokratie“ – demgegenüber jedoch weit weniger im Bewusstsein der handelnden Akteure verankert zu sein scheint.
In der deutschsprachigen Inklusionsforschung erfreute sich der Einfluss sozialer Herkunft als Differenzkategorie auf die Bildungschancen bislang erstaunlich wenig Aufmerksamkeit. Tobias Buchner und Flora Petrik fragen im Rahmen eines qualitativen Forschungsprojekts nach der Bedeutung sozialer Herkunft im Bewusstsein von Lehrkräften, die in inklusiven Settings agieren. Die Befragungen fanden an drei Wiener Mittelschulen (SEK 1) auf der Basis von teilnehmenden Beobachtungen, Befragungen von Leitungskräften, Lehrkräften und Schüler:innen sowie partizipativen Elementen statt. Dabei interessierte insbesondere der Zusammenhang zur Differenzlinie dis/ability. Soziale Herkunft wird zur „diskursiven Ressource, die der Erklärung inklusionspädagogischer Herausforderungen, aber auch des Scheiterns von Inklusion dient“. Anhand empirischer Fallbeispiele zeigen die Autor:innen, wie soziale Herkunft selbst zu einer behindernden Zischreibung mutiert. Das Potenzial, durch inklusive Bildung klassenvermittelten Benachteiligungen entgegenzuwirken, bedarf erst einer ermächtigenden Bearbeitung, die jedoch bislang ebenso kaum erforscht wurde. „Daher ist es lohnend, weitere methodische Annäherungen an Relevantsetzungen sozialer Herkunft bzw. des intersektionalen Zusammenspiels von sozialer Herkunft und Fähigkeit zu erkunden“.
Abschließend analysieren Susann Preiß und Jörg Klewerdie Webpräsenzen deutscher Fachhochschulen auf ihre Barrierefreiheit. Methodisch kontrolliert wurden 207 Fachhochschulen in Deutschland. Es ergaben sich drei Hochschultypen hinsichtlich barrierefreier Webseiten: Nachzügler, Zurückhaltende und Vorreiter. Jedoch besteht trotz gesetzlicher Vorgaben nach wie vor überwiegend z.T. erheblicher Verbesserungsbedarf, sowohl hinsichtlich der technisch barrierefreien Gestaltung als auch bezogen auf die Verfügbarkeit von Informationen zum barrierefreien Studium. Auch zeigt sich dabei die Tendenz, dass private Fachhochschulen noch eine geringere Barrierefreiheit als die staatlichen Hochschulen aufweisen.
Ihnen allen eine anregende und interessante Lektüre wünschen Ihnen
für das Redaktionsteam
Carmen Dorrance und Clemens Dannenbeck