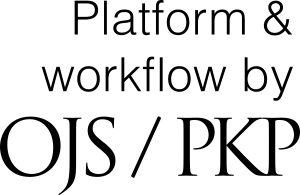In Kooperation mit
und bidokbib, der barrierefreien digitalen Bibliothek von bidok
2-2019
Einleitung
Die Beiträge der vorliegenden Ausgabe „Norm, Behinderung, Gerechtigkeit“ der Zeitschrift für Inklusion (2/2019) gehen zurück auf die Tagung „Erziehungswissenschaftliche Inklusionsforschung. Norm – Behinderung – Gerechtigkeit.“ der AG Inklusionsforschung der DGfE am 28. und 29.06.2018 an der Europa-Universita?t Flensburg.[1] Konkret handelt es sich bei den hier versammelten Beiträgen um solche aus sogenannten „Impulsrunden“, in denen Expert*innen mit den Begriffen Norm, Behinderung und Gerechtigkeit drei Schlu?sselbegriffe der deutschsprachigen Inklusionsdebatte aus unterschiedlichen theoretischen Positionen heraus diskutiert haben. Das diskursive Format eines Impulses sollte bei der Schriftfassung für diese Ausgabe der Zeitschrift für Inklusion ausdrücklich erhalten bleiben. Die Bestimmung dieser drei Begriffe als „Schlüsselbegriffe“ ist als eine vorläufige Setzung zu verstehen, mit der anderen, ebenfalls zentralen Begrifflichkeiten des aktuellen Inklusionsdiskurses wie z.B. Teilhabe, Bildung, Leistung und Ko?rperlichkeit keine geringere Bedeutung zugewiesen werden soll. Im call for papers der Tagung waren diese zusätzlichen Begriffe daher ausdrücklich genannt und in „Themenforen“ diskutiert worden. Dennoch möchten wir an dieser Stelle begründen, warum wir Norm, Behinderung und Gerechtigkeit mit diesem Themenheft erneut in den Vordergrund rücken.
Der Überlegung, eine vertiefte Auseinandersetzung um theoretische Begriffe des Inklusionsdiskurses anzuregen, sind die folgenden Beobachtungen vorausgegangen. Inklusion ist im vergangenen Jahrzehnt im Zuge bildungs- und sozialpolitischer Reformen zu einem zentralen Themenfeld der deutschsprachigen Erziehungswissenschaft in Theoriebildung, empirischer Forschung und universitärer Lehre avanciert. Entsprechende Professuren, bildungspolitische Programme, erziehungswissenschaftliche Studien und Publikationen manifestieren die gewachsene Bedeutung der Inklusionsforschung. Bei genauerer Betrachtung der Forschungen zu Inklusion dra?ngt sich allerdings der Eindruck auf, dass in den letzten Jahren zwar zahlreiche empirische, politische sowie praktisch-pa?dagogische Aktivita?ten entfaltet worden sind, die theoretische Fundierung allerdings nicht in gleichem Maße entwickelt wurde. Um dieses Ungleichgewicht aufzugreifen und zu bearbeiten, ist explizit die Auseinandersetzung mit zentralen Begriffen und ihrer theoretischen Verfasstheit ins Zentrum gestellt worden. Die Wahl ist auf die Begriffe Norm, Behinderung und Gerechtigkeit gefallen, da die Forschung zu Inklusion und Exklusion Fragen nach Bildungsprozessen sowie Behinderungen und Benachteiligungen innerhalb von Bildungs- und Erziehungsorganisationen in den Fokus rückt. Diese sind eng verbunden mit Diskussionen zu Normen bzw. Normalität und Normierungen, da das Verhältnis von Norm und Abweichung als gegenseitiges Konstitutionsverha?ltnis ein zentrales Spannungsfeld sowohl für Forschung als auch für Bildungs- und Erziehungspraxis darstellt. Jede Konstruktion einer Norm – sei es etwa in Bezug auf Bildungs- und Erziehungsziele, Kompetenzen, Körper oder Werte – impliziert gleichermaßen die Konstruktion dessen, was als abweichend betrachtet und gelabelt wird. Diese Annahme gilt selbstredend auch in umgekehrter Richtung. Forschung zu Inklusion und Exklusion greift aber auch Fragen von Gerechtigkeit auf, schließt hier Debatten um soziale Ungleichheiten und Leistungskonzepte an und diskutiert Prozesse gesellschaftlicher Anerkennung von Differenz sowie die Vor- und Nachteile von (De-)Kategorisierungen im jeweiligen gesellschaftlichen Kontext. Diese Begriffe bzw. Konzepte sind nicht nur in sich spannungsreich, sondern sie stehen ebenfalls in spannungsvollen Verha?ltnissen zu anderen erziehungswissenschaftlichen und pa?dagogischen Begriffen, was eine versta?rkte Auseinandersetzung mit theoretischen Positionen umso notwendiger erscheinen la?sst. Auch ist zu fragen, inwieweit und in welcher Form erziehungswissenschaftliche Kernbegriffe und Konzepte vor dem Hintergrund des Diskurses zu Inklusion erneut zu reflektieren sind und inwiefern die Auseinandersetzung mit Inklusion neue Zuga?nge zu ihnen ero?ffnet oder sie in spezifischer Weise konturiert. Es geht also über die Erarbeitung und ‚Vermessung’ von analytischen Begriffen, die dem Gegenstand Inklusion angemessenen sind, hinaus.
Zu den Beiträgen im Einzelnen:
Andrea Platte diskutiert anhand von vier „Beobachtungen“ die Verwendung des Normbegriffs in den Diskursen und Debatten um Inklusion sowie in der „Inklusionsforschung“: Erstens habe der Normbegriff in der inklusionsbezogenen Forschung Konjunktur. Zweitens werde er in der inklusiven Pädagogik meist im Sinne der Anerkennung eines breiten Spektrums von menschlichen Entwicklungen und Eigenkomplexitäten als Normalität verwendet. Drittens habe „Inklusion“ in den letzten Jahren verschiedene Normverschiebungen – z.B. von einer kritisch-normativen zu einer affirmativ-normativen Interpretation innerhalb des selektiven Schulsystems – hervorgebracht. Und viertens zeige sich die Verwendung des Inklusions- und des Normbegriffs als vielfältig, aber v.a. auch als widersprüchlich. Im Fazit dringt Platte auf Wachsamkeit der „Inklusionsforschung“ hinsichtlich Normen und Normierungen.
Der Beitrag „Inklusion und Norm – Inklusion als Norm?“ von Julie A. Panagiotopoulou analysiert die reziproke Verfasstheit der Begriffe Inklusion und Norm. Auf der einen Seite wird – mit etymologischen Bezügen zur sprachhistorischen Herkunft – der Begriff der Norm relational zu Abweichung skizziert. Beispielhaft wird hier die ‚sprachliche Herkunft‘ als abweichend konstruiertes Merkmal in Bildungskontexten angeführt, wodurch Exklusionspotenziale entstehen. Auf der anderen Seite wird der Inklusionsdiskurs kritisch in den Blick genommen, der sich derzeit stark an der in der UN-Behindertenrechtskonvention gesetzten, menschenrechtlichen Norm orientiere und Gefahr laufe, sich so programmatisch als eigenständige Norm zu entfalten, die inhärente Exklusionsmechanismen aufbaue.
Daniel Wrana beleuchtet in seinem Essay die „Normativität der Inklusion“ und unterscheidet dazu in einem ersten Schritt idealtypisch zwei relational miteinander verbundene Verständnisse von Behinderung: ein essentialistisches und ein sozialwissenschaftliches Behinderungsverständnis – letzteres gehe eine Allianz mit der UN-Behindertenrechtskonvention ein. Wrana weist hier u.a. auf die Ambivalenz der (temporären) Deautonomisierung hin und fragt – an Figuren der System- und Gouvernementalitätstheorie angelehnt –, ob die pädagogische Inklusion unter Umständen „als ein Phänomen im Bereich jener Grenze zu verstehen ist, an der die klassische Inklusionsleistung der gesellschaftlichen Teilsysteme neuerlich in die Krise gerät“. Die Grenzen der Pädagogik vermessend arbeitet er heraus, dass Inklusion „Anlass für ein kritisch-transformatives Projekt“ sein könne, dies aber ein gesellschaftliches Projekt sein müsse, in dem „die Rolle von Bildung in modernen Gesellschaften als Ganze in Frage“ und „auf eine andere Grundlage“ gestellt wird, als dies zurzeit „mit Leistungssteigerung und Aktivierung“ gefordert werde.
Thorsten Merl und Petra Herzmann stellen in ihrem Beitrag zu „Inklusion und dis/ability“ Überlegungen aus der Perspektive einer differenztheoretischen Unterrichtsforschung an. Ausgehend von ihrem Forschungsinteresse nach der Funktion, die Differenzierungen entlang der Unterscheidung von fähig/behindert in einem gegenwärtig von schulischen Akteur*innen und Bildungspolitik als inklusiv bezeichneten Unterricht zukommt, nehmen sie eine methodologische Grundlegung vor. Einen zentralen Bezugspunkt bilden dabei Studien ethnographischer Unterrichtsforschung, die diskursive Praktiken des Differenzierens und Normalisierens rekonstruieren und eine kulturtheoretische Modellierung von Behinderung vornehmen. Entlang von ausgewählten Befunden dieser Forschungsrichtung, die Thorsten Merl und Petra Herzmann entlang von drei Foki systematisieren, erörtern sie, welche Erkenntnisse sich aus den Untersuchungen ergeben hinsichtlich der funktionalen Unterscheidung dis/ability für die Aufrechterhaltung und Legitimierung einer unterrichtlichen Leistungsordnung.
Krassimir Stojanov geht der Frage nach, inwiefern Inklusion ein Imperativ von (Bildungs-) Gerechtigkeit ist. Dabei unterscheidet er zwei Gerechtigkeitsparadigmen in ihrer Bedeutung für die moralische Bewertung von schulischer Inklusion: einerseits die Leistungsgerechtigkeit, bei der es um die gerechte Verteilung von Gütern und Ressourcen geht, und andererseits die Anerkennungsgerechtigkeit, bei der die Wertschätzung aller Menschen im Vordergrund steht. Während die Leistungsgerechtigkeit im meritokratischen Sinn nicht zwingend schulische Inklusion impliziere, seien schulische Segregation und Exklusion unter dem Gesichtspunkt von Anerkennungsgerechtigkeit hochgradig ungerecht. Denn die Kultivierung von Leistungsfähigkeit der Schüler*innen sei eine zentrale Aufgabe der Schule und setze Anerkennung als Empathie, Respekt und soziale Wertschätzung voraus, die nur in einem inklusiven Schulsystem für alle verwirklicht werden könne.
In seinem Beitrag „Norm, Behinderung und Gerechtigkeit“ nimmt Erich Otto Graf abschließend die drei dem Themenheft zugrundeliegenden Kernbegriffe auf und skizziert diskursive Verbindungslinien. Nach einer behinderungsbiographischen Einführung entfaltet er zunächst relationale Bezüge zwischen den Begriffen Norm und Behinderung, indem er sie als kulturelle Konstrukte und kulturell stabilisierende Setzungen definiert, durch die gesellschaftliche Vorstellungen manifestiert und machtvoll abgesichert würden. Mit der Frage nach Normen ist also verbunden, wer sie setzen darf. In Relation dazu entwickelt Graf ein Verständnis von Behinderung, das anti-essentialistisch und als politisch verankerte Setzung nicht erfüllter Erwartungen gebunden an Personen zu verstehen sei. Hierdurch werde Behinderung sozusagen zum sozialen Problem, das sich aus „Diskrepanzen zwischen Wahrnehmung einer Situation und Erwartung, wie die Situation sein sollte“ speist und die Frage aufwirft, wie gerecht diese in Bildungsorganisationen bearbeitet bzw. inwiefern diese hervorgerufen werden.
Karin Bräu (Mainz), Jürgen Budde (Flensburg), Andreas Köpfer (Freiburg) und Lisa Rosen (Köln) im Juli 2019.
Die kommenden Themenhefte werden durch Gastherausgeber_innnenschaften gestaltet, weitere Beiträge können aber jederzeit über die Plattform eingereicht werden.
[1] Nach der Vorjahrestagung an der Universität zu Köln, die von den Initiator*innen der AG Inklusionsforschung in der DGfE organisiert wurde (siehe https://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen/arbeitsgemeinschaft-inklusionsforschung.html), wurde diese zweite Arbeitstagung von einem erweiterten Kreis von Erziehungswissenschaftler*innen unterschiedlicher Subdisziplinen vorbereitet und durchgeführt. Dies waren im Einzelnen: Prof. Dr. Karin Bra?u (Universität Mainz), Manfred Bo?ge (CAU Kiel), Prof. Dr. Ju?rgen Budde (Universita?t Flensburg), Jun.-Prof. Dr. Andreas Ko?pfer (PH Freiburg), Adina Ku?chler (LMU Mu?nchen), Prof. Dr. Andrea Platte (TH Ko?ln), Prof. Dr. Lisa Rosen (Universität zu Ko?ln), Prof. Dr. Tanja Sturm (Universität Mu?nster) sowie Dr. Nadja Thoma (Universität Wien).