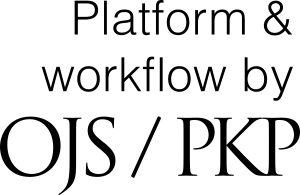In Kooperation mit
und bidokbib, der barrierefreien digitalen Bibliothek von bidok
1-2017
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen hiermit die erste Ausgabe von Inklusion-Online in 2017 an die Hand geben zu können. Inzwischen lässt sich, nach den Reaktionen auf den Ersten Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland und den seit Inkrafttreten der UN-BRK vielfältig erfolgten und kritisierten politischen und praktischen Umsetzungsmaßnahmen, ein verstärktes Bedürfnis nach theoretischer Selbstvergewisserung in den Fachdebatten um eine inklusionsorientierte gesellschaftliche Entwicklung beobachten. Dies wollten wir zum Anlass nehmen, der vorliegenden Ausgabe einen entsprechenden theoretischen Schwerpunkt zu verleihen, der einige Schlaglichter auf aktuelle theoretische Reflexionen des Inklusionsbegriffs wirft.
Will der von der UN-BRK ausgehende Impuls mehr sein als ein unverbindlicher Aufruf zur selektiven Optimierung der Integration von Menschen mit Behinderungen im Bildungssystem, so scheint ein kritisches Nachdenken über die gesellschaftstheoretischen Grundlagen und aktuellen Bedingungen sozialen Wandels, die den Inklusionsdiskurs ebenso rahmen wie die sich auf ihn berufenden Akteure von ihnen geprägt werden, unverzichtbar. Nicht nur dort, wo eine inklusive Praxis auf Skepsis oder gar Ablehnung stößt, sondern auch da, wo sie sich als ‚Lösung’ gesellschaftlicher ‚Probleme’ anbietet, scheint ein kritischer Blick auf die Repräsentation der Problemstellung selbst, durchaus angeraten. Es lässt sich kaum von dem Verdacht ablenken, dass unter den Bedingungen einer Abstiegsgesellschaft (Oliver Nachtwey) gar nicht die Absicht besteht, eine inklusionsorientierte Entwicklung zu verfolgen. Sind doch nicht so sehr Vorurteile gegen Menschen mit Behinderung das hervorstechendste Problem, auch nicht die ‚natürlicherweise’ begrenzten finanziellen Handlungsspielräume, sondern eine sich zunehmend unverblümte entsolidarisierende Gesellschaft. Soziale Distinktion avanciert zum bevorzugten Hebel der Selbstvergewisserung für diejenigen, die sich in einer Zone der Verwundbarkeit (Castel) wiederfinden und vermeintlich oder tatsächlich ihre Felle davon schwimmen sehen. „Der arbeitswütige Selbstproduktivismus ist das Merkmal eines wettbewerblichen Selbst, das offenbar keine Möglichkeit sieht, im Umgang mit Unsicherheit, Abstiegsangst und intensivierter Markvergesellschaftung soziale und solidarische Wege zu finden“ (Nachtwey, 166).
Eine überblickshafte Systematisierung von Theoriezugängen zu Inklusion in einem kritischen und politischen Verständnis legt Mai-Anh Boger vor. Ihr Interesse gilt vornehmlich der (Re-)Politisierung eines Inklusionsbegriffs im Sinne von Differenzgerechtigkeit und Diskriminierungsfreiheit, der den Dialog mit ‚Betroffenenbewegungen’ praktiziert. Verbunden ist ihr Ansatz mit einem provokativen Angebot zur Reflexion der Selbstpositionierung in Sachen Inklusion und Diskriminierungs(forschung), das eine transdisziplinäre Perspektive auf positionierte Produktionen von Widerstandswissen eröffnet. Grundlage ihrer Überlegungen bildet ein Projekt, das die unterschiedlichen Theoriezugänge zu Inklusion sammelt, analysiert und systematisiert. Mai-Anh Boger unterscheidet dabei Inklusion im Sinne von Empowerment, von Normalisierung und von Dekonstruktion. Dabei gelangt sie zu einer "trilemmatischen" Schlussfolgerung, was bedeutet, dass sich jeweils bestenfalls zwei dieser Positionen aufeinander beziehen lassen und die jeweils dritte einen theoretisch-logischen Widerspruch bildet. Diese Perspektive erlaubt nicht nur einen erhellenden Blick auf den Stand und Verlauf der Diskussion(en) um Inklusion, sondern eröffnet auch (zumindest die Hoffnung) auf eine kritische Perspektive zukünftiger Diskriminierungsforschung, die sich einer differenzsensiblen Haltung in reflexiver Weise bedient.
Uwe Becker verdeutlicht in seinem Beitrag seine Rede von der Inklusionslüge als gesellschaftliche Verschleierung der systemimmanten Exklusionslogiken, die hier am Schulsystem und am Arbeitsmarkt beispielhaft aufgezeigt werden. Zunächst wird die juristische Bedeutung der ratifizierten UN-BRK als Staatsverpflichtung, aus der nicht zwangsläufig individuelle Rechte abgeleitet werden können, skizziert. Dem entspricht die bisher hierzulande zu beobachtende sogenannte Inklusionspolitik, die sich in vielen Fällen auf einen am Primat weitgehender Kostenneutralität orientierten Appell an die Zivilgesellschaft beschränkt. Im Bereich Schule führt diese Argumentationsstrategie u.a. dazu, den Besuch einer Regelschule als vollzogene Inklusion zu werten und vom geforderten Blick auf die Qualität des Regelschulbetriebs abzulenken. Ebenso erweist sich das Tripel-Mandat der Werkstätten, bestehend aus Rehabilitation, Qualifizierungs- und Integrationsleistung als widersprüchlich in Bezug auf die inklusionstheoretische Herausforderung. Sowohl die strukturellen Bedingungen des Schulsystems wie der institutionalisierte Umgang mit Menschen mit Behinderung in Bezug auf deren Integration in den Arbeitsmarkt erscheinen jedoch als systemimmanent logisch, insofern sie die einem flexiblen Kapitalismus angemessenen Voraussetzung zur Systemreproduktion sicherstellen. Damit aber erweisen sich Inklusionsrhetoriken als Verschleierungsstrategien im Dienste der Systemstabilisierung. Sie immunisieren sich sowohl gegen eine theoretische Reflexion der Grundlagen des gesellschaftlichen Verhältnisses von Inklusion/Exklusion als auch gegen eine politische Kritik, die darauf abzielt, jene Systeme von Grund auf zu ändern.
?Robert Schneider untersucht bildungsphilosophisch und -theoretisch die Bildsamkeit der Person in ihrer Bedeutung für eine inklusionspädagogische Theorie und Praxis. Unter Bezugnahme auf Sterns Kritischen Personalismus entwirft er ein Konzept von Bildsamkeit, das in Verbindung mit Anerkennung als Bedingung der Möglichkeit von personalem Handeln aufscheint und auf diese Weise progressives Potenzial zu entfalten vermag. Dabei zeigt sich zugleich auch das kritische Potenzial einer so begründeten Inklusionspädagogik, insofern Wert- und Bewertungslogiken in Bildungsprozessen diesem Verständnis zuwiderlaufen. Anerkennung erfordert die Mitwirkung der Person an ihrer Bestimmung im Sinne eines Möglichkeitsraumes, wodurch jeglicher allein von außen auferlegter begrenzender Bestimmung von Bildung eine Absage erteilt ist. "Grenzen werden aber (...) dann als notwendig auszuweisen sein, wenn diese aus der inneren Entscheidung einer Person heraus zur Ermöglichung der Selbstbestimmung eines Du beitragen können".
Sven Bärmig plädiert für eine Reflexion der Konzeptualisierung von Inklusion/Exklusion in Bezug auf Schule und Bildung in der wissenschaftstheoretischen Tradition kritischen Denkens. Er knüpft zu diesem Zweck auf Basis der Rezeption (sonder)pädagogischer und inklusionspädagogischer Literatur gedankliche Ansatzpunkte, die alles inklusionstheoretische Wissen (und Handeln) als notwendigerweise gesellschaftstheoretisch verortet und unhintergehbar reflexionsbedürftig begreift. Orientiert an Adorno spricht er sich für eine theoretische Fassung eines Inklusionsverständnisses aus, die sich auf Vorstellungen von Autonomie und Mündigkeit beruft, was sich in letzter Konsequenz in der gesellschaftlichen Praxis erst noch erweisen muss.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
Carmen Dorrance und Clemens Dannenbeck?
für die Redaktion von Inklusion-Online