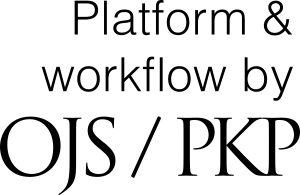Call for Papers: „Verständnisse von Inklusion und Exklusion“
für die Ausgabe 03/2026
Die Zeitschrift für Inklusion feiert 2026 ihr 20-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass wird mit diesem Call for Papers zu Beiträgen für eine Schwerpunktausgabe (03/2026) aufgerufen, die sich grundlegend und ausführlich mit Verständnissen von Inklusion und Exklusion befasst.
Aufgrund der weitreichenden Verwendung des Begriffs Inklusion, u.a. im erziehungswissenschaftlichen Fachdiskurs in den vergangenen Dekaden, sowie seiner menschenrechtlichen Positionierung durch die UN-Behindertenrechtskonvention haben sich verschiedene Verständnisse von Inklusion entwickelt – die, grob skizziert, zwischen normativ-programmatischen Setzungen und einer sozialwissenschaftlichen Relationierung von Inklusion und Exklusion changieren. Wurde vormals der Inklusionsbegriff eher in der Soziologie oder Theologie verwendet, hat die Einführung des Begriffs in den erziehungswissenschaftlichen und primär schulpädagogischen Diskurs – zunächst im anglo-amerikanischen Raum und später auch im deutschsprachigen Diskurs – je nach Einschätzung zu einer terminologischen Profilierung und Weiterentwicklung von Teilhabeverhältnissen (Hinz 2002), zu einer babylonischen Sprachverwirrung (Wocken 2010) oder zu notwendigen „Selbstvergewisserungen der Sonderpädagogik“ (Miethe et al. 2017, 16) geführt.
Während die Unterscheidung von Integration und Inklusion nach wie vor häufig als zentrale und überwiegend normative Strukturierungshilfe für Teilhabeordnungen dient (vgl. u.a. Jahnukainen 2015, bereits früh Hinz 2002) und sich in der Folge Rekurrierungen auf ‚enge‘ (auf Behinderung bezogene) und ‚weite‘ (unterschiedliche Heterogenitätsdimensionen in den Blick nehmende) Verständnisse von Inklusion etabliert haben, wurden auch empirische Systematisierungsversuche von Definitionen und Verständnissen von Inklusion aus dem Forschungs- und Fachdiskurs vorgelegt (vgl. z.B. Grosche 2015). Häufig beziehen sich diese Verständnisse auf Inklusion im schulischen Kontext. Aus international vorherrschenden Diskursen haben zum Beispiel Göransson und Nilholm (2014, 268, s. auch Nilholm & Göransson 2017) hierzu Inklusionsverständnisse entlang von vier zentralen Mustern systematisiert: (A) Placement definition – inclusion as placement of pupils with disabilities/in need of special support in general education classrooms; (B) Specified individualised definition – inclusion as meeting the social/academic needs of pupils with disabilities/pupils in need of special support; (C) General individualised definition – inclusion as meeting the social/academic needs of all pupils; (D) Community definition – inclusion as creation of communities with specific characteristics. Daran wird deutlich, dass eine Ambivalenz in der Aufrufung entweder spezifischer (in der Regel als sonderpädagogisch bzw. förderbedürftig markierter) Personenkreise oder – mit generalistischer Perspektive – aller Schüler:innen auszumachen ist. Köpfer (2019) hat in seinem Systematisierungsversuch auf die Leerstelle von systembezogenen Inklusionsverständnissen hingewiesen, da die landläufige Differenzierung in ‚enge‘ und ‚weite‘ Inklusionsverständnisse letztlich eine personengruppenbezogene Askription beinhalte. So stellt er eine Erweiterung von Inklusionsverständnissen um eine systembezogene Ebene vor, in der sich behinderungs-/benachteiligungsbezogene sowie differenztheoretische Verständnisse befinden, die stärker auf den Konstruktionscharakter von Be-Hinderung und Differenz hinweisen (vgl. ebd., 145).
Die Entwicklung einer (zunehmenden) Ausdifferenzierung von Perspektiven auf Inklusion, gerade mit Blick auf Rekontextualisierungen an der Schnittstelle von theoretischen Modellen und Handlungspraxen in (Bildungs-)Organisationen, erscheint vor diesem Hintergrund verständlich und notwendig. Gleichzeitig zeigen sich – gerade entlang der Schnittstelle praxeologischer und politisch-normativer Verständnisausprägungen – bisweilen gegenläufige Verständnisse, die mal systemkritische Transformationsnotwendigkeiten, mal eine affirmative Funktionalisierung von Strukturen entlang des Begriffs Inklusion aufrufen. So changieren Inklusionsverständnisse, je nach Einsatz, zwischen feldspezifisch harmonischem Nebeneinander und umkämpften (machtvollen) Rahmungen und Deutungshoheiten.
Erstaunlicherweise gibt es bisher wenige Zeitschriftausgaben oder Anthologien, die sich fokussiert mit Verständnissen von Inklusion auseinandersetzen bzw. Beiträge hierzu versammeln. Zudem zeigt sich, dass im (inter-)nationalen Diskurs bislang nahezu keine Systematisierungsversuche von Verständnissen von Exklusion zu erkennen sind. Ebenso wie Inklusion kann Exklusion höchst different, relational und situativ konnotiert sein und sich in Verständnissen von z.B. Bildungsungleichheiten, (sozialer) Marginalisierung, ableistischen Bildungskulturen und -architekturen sowie rassistische, linguizistische und geschlechtsbezogene Exklusionsmustern u.v.m. ausdrücken.
Vor diesem Hintergrund soll sich die Ausgabe 03/2026 der Zeitschrift für Inklusion diesem Thema zuwenden und entlang von theoretischen und empirischen Artikeln weiter zur Erkundung und Profilierung von Verständnissen von Inklusion und Exklusion im (inter-)nationalen Kontext beitragen.
Unterschiedliche Thematisierungen sind also vorstellbar, zum Beispiel:
- Theoretische Perspektivierungen (aus unterschiedlichen Diskursen wie z.B. Sozialphilosophie, Disability Studies, Soziologie, Psychologie, Teilhabeforschung, …);
- (Inter-)nationale, transnational-vergleichende, kulturvergleichende, post-/dekoloniale etc. Perspektiven auf Inklusion und Exklusion;
- Empirische Perspektivierungen aus unterschiedlichen methodologischen-methodischen Zugängen heraus;
- (Empirische) Systematisierungen von Inklusions- und Exklusionsverständnissen artikuliert durch unterschiedliche Akteur:innen in (Bildungs-)Organisationen, z.B. Schüler:innen, Fachkräfte, Bildungsadministration, Eltern etc., und aus unterschiedlichen Handlungsfeldern heraus (z.B. schulischer Ganztag, offene Kinder- und Jugendarbeit, berufliche Bildung, Kommunen, Hochschulen, u.v.m.);
- Fragen des Umgangs mit Kategorien, u.a. entlang der Themen von Intersektionalität, (De-)Kategorisierung etc.;
- Fragen von Normativität an der Schnittstelle von Theorie und Praxis;
- …
Wir möchten mit diesem Themenheft weiter zur Debatte um Perspektivierungen von Inklusion und Exklusion beitragen. In dieser Hinsicht freuen wir uns über empirische wie theoretische Beiträge, nationale wie internationale Beiträge, Beiträge in deutscher wie englischer Sprache.
Bitte reichen Sie Ihre Beiträge bis spätestens 31.03.2026 ein.
Die Redaktion der Zeitschrift Inklusion-Online
Informationen zur Zeitschrift Inklusion-Online sowie die Manuskriptrichtlinien finden Sie unter
https://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/about/submissions#authorGuidelines
Einreichungen bitte nur über die Internet-Plattform
Literatur:
Göransson, K. & Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings – a critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education 29(3), 265–280.
Grosche, M. (2015). Was ist Inklusion. Ein Diskussions- und Positionsartikel zur Definition von Inklusion aus Sicht der empirischen Bildungsforschung. In. P. Kuhl et al. (Hrsg.), Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Schulleistungserhebungen (S. 17-39), Wiesbaden: Springer.
Hinz, A. (2002): Von der Integration zur Inklusion – terminologisches Spiel oder konzeptionelle Weiterentwicklung? Zeitschrift für Heilpädagogik 53(2), 354–361.
Jahnukainen, M. (2015) Inclusion, integration, or what? A comparative study of the school principals’ perceptions of inclusive and special education in Finland and in Alberta, Canada, Disability & Society 30(1), 59–72.
Köpfer, A. (2019): Rekonstruktion behinderungsbedingter Differenzproduktion in inklusionsorientierten Schulen. In: J. Budde, A. Dlugosch, P. Herzmann, L. Rosen, A. Panagiotopoulou, T. Sturm & M. Wagner-Willi (Hrsg.): Inklusionsforschung im Spannungsfeld von Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik (S. 143-164). Opladen: Barbara Budrich.
Miethe, I., Tervooren, A., & Ricken, N. (2017). Bildung und Teilhabe. Wiesbaden: Springer VS.
Nilholm, C. & Göransson, K. (2017). What Is Meant by Inclusion? European Journal of Special Needs Education 32(3), 437–451.
Wocken, H. (2010): Integration & Inklusion. Ein Versuch, die Integration vor der Abwertung und die Inklusion vor Träumereien zu bewahren. In A.-D. Stein, I. Niediek & S. Krach (Hrsg.), Integration und Inklusion auf dem Weg ins Gemeinwesen. Möglichkeitsräume und Perspektiven (S. 204-234). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.