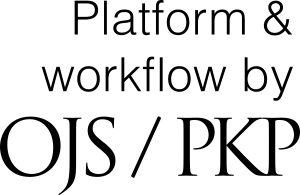In Kooperation mit
und bidokbib, der barrierefreien digitalen Bibliothek von bidok
3-2025
Editorial zur Ausgabe „Medien und Teilhabe“
Karin Cudak
Der familiale, freizeit- und bildungsbezogene Alltag von Kindern und Jugendlichen ist heute medial und digital geprägt – von Lebensbeginn an. Neben Foto-, Bild-, Video-, Bücher- und Textwelten werden kommerzielle Anbieter wie WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram und Snapchat sowie Google per Smartphone und Tablet von nahezu allen Kindern und Jugendlichen genutzt. Artificial Intelligence (AI) und Virtual Reality-Erfahrungen (VR) prägen den Alltag von Heranwachsenden zusätzlich und intensiviert. Auch Bildungsorganisationen, angefangen von der Krippe bis hin zum tertiären Bildungsbereich, nutzen Medienumwelten, -plattformen und mediale Produkte zunehmend, um Lern- und Bildungsprozesse zu planen, anzuleiten und zu evaluieren.
Spannend ist auch der Zusammenhang zwischen Dis-/Ability-Konstruktionen und digitalen Medien: Während die Nutzung digitaler Medien im vorschulischen Bildungsbereich im öffentlich-politischen Diskurs eher skeptisch und mit Hinweis auf potentielle ‚Entwicklungsrisiken‘ (u. a. ‚Bildschirmsucht‘, ‚Aufmerksamkeitsdefizite‘ und ‚Bewegungsmangel‘) begegnet wird, wird im Primar-, Sekundar- und Hochschulbereich der unzureichende Ausbau digitaler Infrastruktur eher bemängelt. Hier wird dann der Aufbau von Medienkompetenzen – auf Seiten der Fachkräfte wie auf Seiten der Bildungsadressat*innen – gefordert und zum bildungs- und inklusionspolitischen Ziel erklärt.
Während sich mediale Umwelten heute also massiv ausdifferenziert haben, unterliegen sie gleichzeitig auch einem sozial-technologischen Shift von ehemals schwerpunktmäßig analogen (Massen-)Medien hin zu digitalen, immersiven und netzwerk-geprägten Medienlandschaften. Dieser technologische Wandel ist mit einem sozialkulturellen Wandel verknüpft, so dass heute andere institutionelle, soziale und individuelle Fähigkeiten gefragt sind, wenn es um souveräne und selbstbestimmte Mediennutzung und -repräsentation geht. Fehlen diese Fähigkeiten, können sich Sorgen, Versagensängste oder Gefühle von persönlicher Unzulänglichkeit und Unfähigkeit einstellen, welche Handlungsspielräume und Teilhabemöglichkeiten limitieren.
Medien können aber auch als innovierte Formate und Arrangements neue Zugänge, individuelle Inklusionsmuster und damit auch Anschlüsse zu inklusiver Bildung, Empowerment und post-kategorialer und post-ableistischer Solidarität schaffen. Hierzu zählen z. B. Fragen nach Mitsprache- und Teilhabeansprüchen sowie nach Gerechtigkeit und Fairness. Das Cripping-Up beispielsweise wird von Selbstvertreter*innen längst als ableistische Praxis diskutiert.[i]
Mediennutzung, ihre Nutzungsrechte und -ansprüche wie auch Fragen der medialen Repräsentation sind also eng mit Inklusion und Teilhabe verbunden. In Bezug auf die facettenreiche und relationale Kategorie Behinderung eröffnen sich sowohl für die Praxis inklusiver Bildung als auch für die inklusions-orientierte Bildungs- und Erziehungswissenschaft zahlreiche Fragen und Erkenntnisbedarfe.
Und während die medial-digitalen Transformationen und die gesellschaftlichen Aushandlungen von Zugangs- und Nutzungsrechten, digitaler Souveränität sowie digitalen Ungleichheiten weiter voranschreiten, greift die vorliegende Ausgabe 3-2025 der Zeitschrift für Inklusion von den hier angesprochen Aspekten eine – wie wir finden – spannende Auswahl an Fragen auf, darunter:
1. Wie werden „Dis-/Ability-Konstruktionen und die Differenz(ierungs)kategorie geistige Behinderung in der Argumentation um den (Nicht-)Einsatz digitaler Medien in den didaktischen Praxen der Schule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt Geistige Entwicklung von Sonderpädagog:innen (re)produziert und aufrechterhalten“ (Christin Kupitz)?
2. Wie kann „transformative Bildung Menschen nicht nur zur technischen Anpassung, sondern zur aktiven Mitgestaltung einer inklusiven und KI geprägten Gesellschaft befähigen“ (Daniel Autenrieth, Jan-René Schluchter & Lea Schulz)?
3. Welche In- und Exklusionsmomente in Bezug auf Teilhabechancen von Menschen mit Behinderungen an Virtual Realty (VR) lassen sich – gerade auch vor dem Hintergrund bestehender digitaler-ableistischer Ungleichheiten – in der aktuellen Studienlandschaft identifizieren? Und welche Bedeutung kommen hierbei dem Embodied Learning und Dis-/ Abillity-Konstruktionen zu (Dorina Rohse)?
4. „Kann VR die Motivation und den Wissenserhalt in verschiedenen Fächern sowie in der beruflichen Bildung durch immersive und anpassbare Lernumgebung steigern? Kann die aktive Auseinandersetzung mit neuen Situationen und unbekannten Umgebungen abseits gewohnter Routinen in der Übergangsphase von der Schule in den Beruf gezielt unterstützt werden?“ (Ingo Bosse, Verena Wahl, Dorina Rohse et al.)?
5. Wie ungleichheitsgeprägt stellt sich die digitale Mediennutzung von Jugendlichen mit Beeinträchtigung der körperlichen und motorischen Entwicklung gegenwärtig dar (Jakob Sponholz & Kathrin Wolf)?
6. Wie können medienpädagogische Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) vor dem Hintergrund der Novellierung des SGB VIII im Rahmen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) „an die vielfältigen Bedürfnisse heterogener Zielgruppen angepasst werden“? Welche Herausforderungen treten dabei in „der Praxis inklusiver Medienarbeit“ auf und welche erfolgreichen Umsetzungsstrategien für inklusive Medienprojekte existieren bereits (Melanie Schaumburg)?
Wir wünschen Ihnen erkenntnisreiche und überraschende Einblicke in dieses spannende Feld sowie eine gute Lektüre!
Prof. Dr. Karin Cudak
[i] https://dieneuenorm.de/kultur/cripping-up-warum-man-identitaet-nicht-spielen-sollte/ vom 26.09.2025.